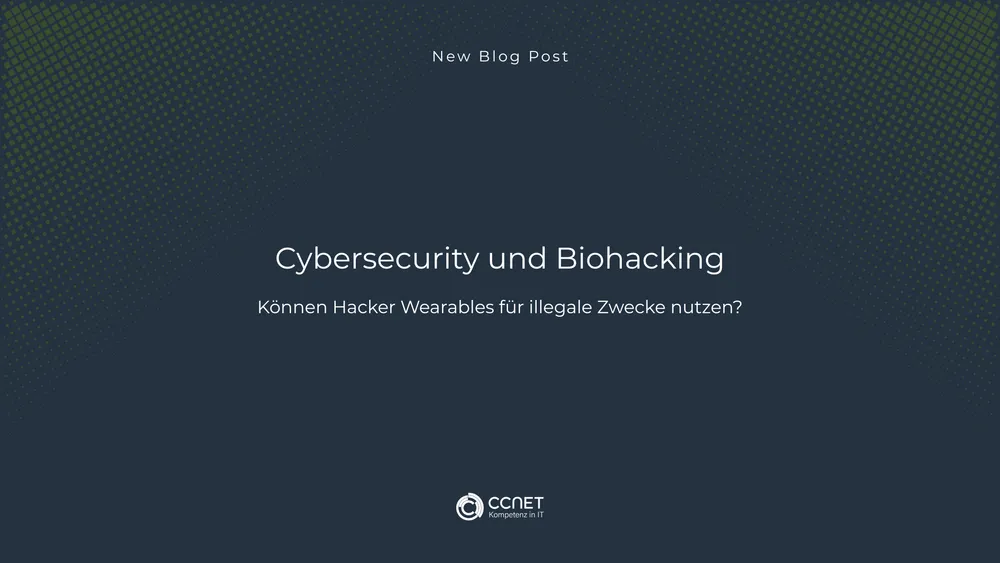CCNet
25. Aug. 2025 • 2 Min. Lesezeit

Smarte Medizin: Einführung in die Cybersicherheitsaspekte von Gesundheits-Wearables
Wearables mit medizinischen Funktionen erfreuen sich wachsender Beliebtheit, da sie Gesundheitswerte wie Herzfrequenz, Blutsauerstoffgehalt oder sogar EKG-Daten erfassen können. Doch sobald ein Wearable nicht nur der allgemeinen Fitnessüberwachung dient, sondern medizinische Diagnosen unterstützt oder als Hilfsmittel für Patienten eingesetzt wird, gelten strengere gesetzliche Anforderungen. In der EU unterliegen solche Geräte der Medical Device Regulation (MDR). Doch was bedeutet das für Hersteller, und welche Kriterien müssen erfüllt werden?
1. Wann gilt ein Wearable als Medizinprodukt?
Nicht jedes Gesundheits-Wearable wird automatisch als Medizinprodukt eingestuft. Entscheidend ist der beabsichtigte Verwendungszweck. Ein Wearable wird dann als Medizinprodukt eingestuft, wenn es:
- Zur Überwachung oder Behandlung von Krankheiten dient,
- Diagnostische Funktionen übernimmt,
- Medizinische Entscheidungen unterstützt.
Beispiel: Ein Fitness-Tracker, der nur allgemeine Aktivitätsdaten misst, fällt nicht unter die MDR. Ein Wearable, das unregelmäßige Herzrhythmen erkennt und eine Warnung ausgibt, hingegen schon.
2. Welche Anforderungen stellt die MDR an Wearables?
Die EU-Medizinprodukteverordnung MDR (Medical Device Regulation, Verordnung (EU) 2017/745) regelt, welche Anforderungen Medizinprodukte erfüllen müssen. Für Wearables bedeutet das:
- Klassifizierung des Produkts: Medizinische Wearables werden je nach Risiko in verschiedene Klassen eingeteilt (I, IIa, IIb, III).
- Klinische Bewertung: Hersteller müssen nachweisen, dass ihr Gerät sicher und wirksam ist.
- Technische Dokumentation: Eine umfassende Dokumentation über die Sicherheit, Wirksamkeit und Fertigung des Geräts ist erforderlich.
- Zertifizierung durch eine Benannte Stelle: Höherklassifizierte Wearables müssen von einer zugelassenen Prüfstelle zertifiziert werden.
- Post-Market-Surveillance: Hersteller müssen nach dem Verkauf kontinuierlich überwachen, ob das Produkt sicher bleibt.
3. Herausforderungen für Hersteller von Wearables
Die Einstufung als Medizinprodukt bringt einige Herausforderungen mit sich:
- Langer Zertifizierungsprozess: Die MDR stellt hohe Anforderungen an Nachweise zur Sicherheit und Wirksamkeit.
- Erhöhte Haftung: Hersteller tragen die Verantwortung für Schäden durch fehlerhafte Daten oder falsche Diagnosen.
- Datenschutzanforderungen: Wearables müssen nicht nur medizinischen, sondern auch datenschutzrechtlichen Vorgaben wie der DSGVO entsprechen.
4. Auswirkungen auf den Markt für Gesundheits-Wearables
Viele Hersteller müssen ihre Wearables umgestalten oder neue Genehmigungen einholen, um den MDR-Anforderungen zu entsprechen. Einige Unternehmen haben ihre Produkte sogar vom europäischen Markt zurückgezogen, weil die Umsetzung zu aufwendig ist. Gleichzeitig eröffnet die Einhaltung der MDR aber auch neue Marktchancen, da zertifizierte medizinische Wearables im Gesundheitswesen eine größere Akzeptanz finden.
5. Fazit: Regulierungen als Qualitätssicherung
Die MDR stellt hohe Anforderungen an Wearables mit medizinischer Funktion, doch sie schützt damit auch Patienten und Nutzer. Hersteller, die sich diesen Vorgaben stellen, können langfristig Vertrauen aufbauen und sich im Gesundheitsmarkt behaupten. Unternehmen sollten frühzeitig prüfen, ob ihr Wearable als Medizinprodukt gilt, um Verzögerungen und rechtliche Probleme zu vermeiden.
Im nächsten Beitrag beschäftigen wir uns mit der Frage: „Cybersecurity by Law: Welche neuen Gesetze für Wearables kommen auf uns zu?“