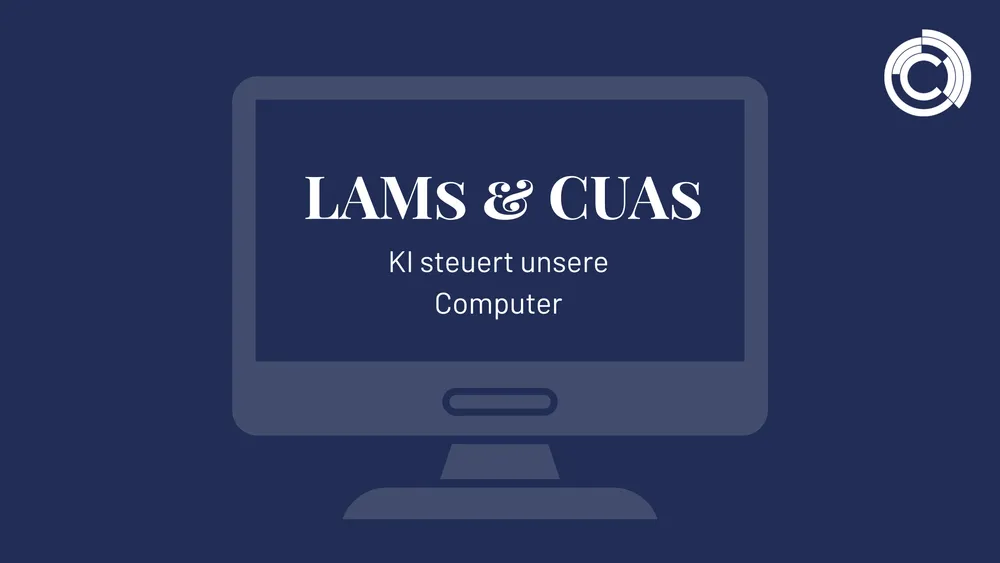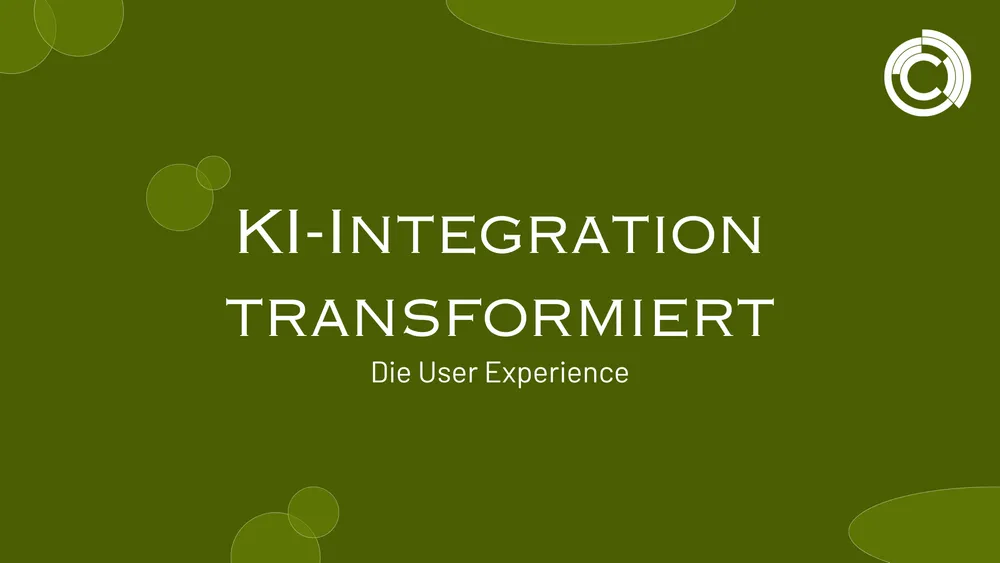CCNet
24. Sep. 2025 • 2 Min. Lesezeit

Low-Code & No-Code – Softwareentwicklung für alle
Der Druck auf Unternehmen, digitale Lösungen schneller bereitzustellen, wächst stetig. Fachkräftemangel in der IT, steigende Kosten und immer komplexere Anforderungen stellen Management und IT-Abteilungen gleichermaßen vor Herausforderungen. Low-Code- und No-Code-Plattformen versprechen einen Ausweg: Sie ermöglichen es, Anwendungen zu entwickeln, ohne tiefes Programmierwissen zu benötigen. 2025 erleben wir den Durchbruch dieser Technologie – und sie verändert, wie Unternehmen Software einsetzen und entwickeln.
Was steckt hinter Low-Code und No-Code?
Low-Code- und No-Code-Plattformen bieten visuelle Oberflächen, mit denen Nutzer:innen per Drag-and-Drop Anwendungen bauen können. Low-Code richtet sich an Entwickler:innen, die mit wenig Code schneller komplexe Anwendungen erstellen wollen. No-Code dagegen öffnet die Tür für Fachabteilungen, die ohne IT-Hintergrund eigene Lösungen entwickeln. Dieser Trend wird auch als Citizen Development bezeichnet – Mitarbeitende werden zu Schöpfern digitaler Werkzeuge.
Ein Booster für die Digitalisierung
Für Unternehmen ist das Potenzial enorm:
• Geschwindigkeit: Entwicklungszeiten verkürzen sich von Monaten auf Tage.
• Kosteneffizienz: Weniger externe Entwickler:innen werden benötigt.
• Flexibilität: Fachbereiche können Lösungen eigenständig entwickeln, die genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Ein anschauliches Beispiel: Statt lange auf die IT-Abteilung zu warten, kann eine Vertriebsleiterin mit einer No-Code-Plattform selbst ein Tool erstellen, das Angebote automatisch generiert und die Pipeline visualisiert.
Marktdynamik und Prognosen
Analysten prognostizieren, dass bis 2025 über 70 % der Anwendungsentwicklung auf Low-Code basieren wird – gegenüber nur 20 % im Jahr 2020. Bis 2028 könnte der Markt ein Volumen von über 50 Milliarden US-Dollar erreichen. Große Anbieter wie Microsoft, Salesforce oder HP treiben die Entwicklung massiv voran. Neue KI-gestützte Tools wie GitHub Spark oder Cursor zeigen bereits heute, wie Produktivitätssprünge möglich sind.
Chancen für das Management
Für Entscheider:innen ergeben sich klare Vorteile:
• Digitale Transformation beschleunigen: Innovationen können schneller umgesetzt werden.
• Fachkräftemangel abfedern: Auch ohne große Entwicklerteams entstehen Lösungen.
• Engere Zusammenarbeit: IT und Fachbereiche rücken näher zusammen, da beide an der Entwicklung beteiligt sind.
Damit sind Low-Code- und No-Code-Plattformen mehr als nur ein technisches Werkzeug – sie sind ein strategisches Instrument, um Wettbewerbsvorteile zu sichern.
Risiken und Herausforderungen
So verlockend die Möglichkeiten sind, sie bringen auch neue Fragen mit sich:
• Abhängigkeit von Plattformen: Unternehmen riskieren eine starke Bindung an einzelne Anbieter.
• Qualität und Sicherheit: Wenn Anwendungen ohne tiefe Programmierkenntnisse entstehen, können Fehler oder Sicherheitslücken übersehen werden.
• Kompetenzverlust: Es besteht die Gefahr, dass klassische Programmierfähigkeiten in Teams abnehmen.
Für das Management bedeutet das: Low-Code und No-Code erfordern klare Governance-Regeln. Ohne strategischen Rahmen laufen Unternehmen Gefahr, eine unkontrollierte Schatten-IT entstehen zu lassen.
Fazit: Demokratisierung mit doppelter Wirkung
Low-Code- und No-Code-Plattformen machen Softwareentwicklung zugänglicher denn je. Sie beschleunigen die Digitalisierung, senken Kosten und stärken die Innovationskraft. Gleichzeitig müssen Unternehmen aufpassen, den Spagat zwischen Freiheit und Kontrolle zu meistern. Wer jetzt auf klare Richtlinien setzt und Pilotprojekte startet, kann das volle Potenzial ausschöpfen – und sich einen entscheidenden Vorteil im digitalen Wettbewerb sichern.
Weitere Informationen finden Sie hier: AI Trends 2025
FAQ zu AI Trends 2025
Was ist der Unterschied zwischen Low-Code und No-Code?
Low-Code richtet sich an Entwickler:innen, No-Code an Fachabteilungen ohne Programmierkenntnisse.
Warum gelten diese Plattformen als „Booster“ für Digitalisierung?
Sie verkürzen Entwicklungszeiten massiv und senken Kosten.
Was versteht man unter „Citizen Development“?
Fachabteilungen entwickeln eigene Anwendungen ohne IT-Hintergrund.
Welche Risiken bestehen bei unkontrolliertem Einsatz?
Schatten-IT, Qualitätsprobleme und Sicherheitslücken.
Wie stark wächst der Markt?
Analysten erwarten bis 2025 über 70 % Low-Code-Anteil an der Softwareentwicklung.
Welche Rolle spielt Governance?
Ohne klare Regeln drohen Chaos und unkontrollierte Anwendungen.