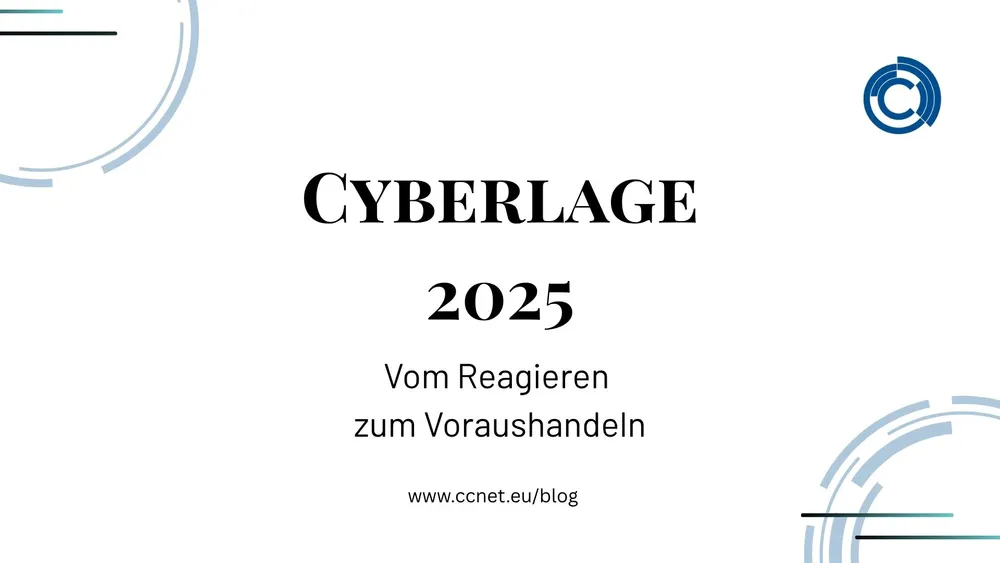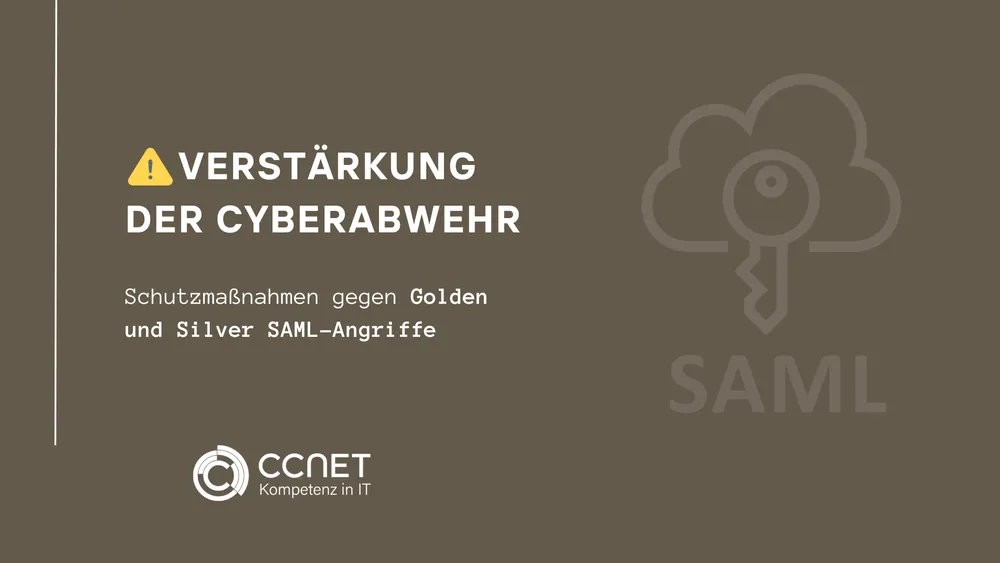CCNet
5. Nov. 2025 • 3 Min. Lesezeit
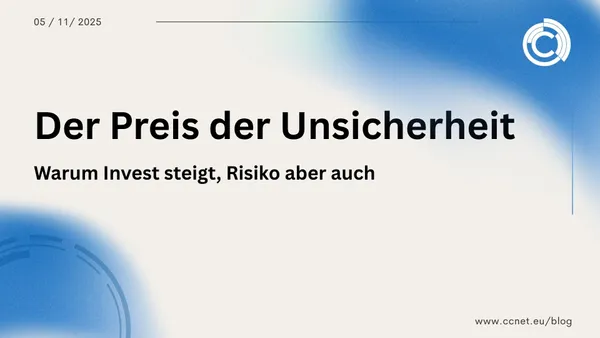
Der Preis der Unsicherheit: Warum Invest steigt, Risiko aber auch
Das Paradox: Mehr Ausgaben, gleiches Risiko
Unternehmen geben Jahr für Jahr mehr für IT-Sicherheit aus – und trotzdem bleibt das Cyberrisiko hoch. Der Grund ist unbequem: Investitionen verteilen sich oft auf isolierte Einzelprodukte, ohne belastbare Zielarchitektur, ohne harte Betriebsziele und ohne belastbare Metriken. Ergebnis: höhere Lizenz- und Betriebskosten, aber kaum Gewinn bei Erkennung, Eindämmung und Wiederanlauf. Wer nur einkauft, statt Fähigkeiten zu bauen, produziert sichtbare Aktivität – jedoch wenig messbaren Schutz. Kurz: Ohne stringentes Risikomanagement und klare Leitplanken wird jedes zusätzliche Security Budget zu teurem Leerlauf.
Wo das Geld versickert: Tool-Zoo & Übergabelücken
Der „Tool-Zoo“ ist nicht nur ein Einkaufsthema, sondern ein Betriebsrisiko. Jedes weitere Produkt bringt Konnektoren, Logik, Rollen, Pflege, Upgrades und neue Fehlerquellen mit. Übergaben zwischen Teams geraten zu Reibungszonen: Alerts wandern durch mehrere Systeme, bis sie jemand wirklich bewertet. Angreifer nutzen genau diese Latenzen. Typische Symptome:
- Doppeltes Monitoring, aber keine Ende-zu-Ende-Sicht.
- Widersprüchliche Policy-Sets, weil jede Lösung „ihr eigenes Ding“ macht.
- Hohe Change-Kosten, weil jede Änderung mehrere Silos berührt.
- Abhängigkeit von einzelnen Anbietern, die bei Störungen ganze Ketten lahmlegen.
Ohne Tool-Konsolidierung steigen Integrationsaufwand und Komplexität schneller als der Sicherheitsgewinn. Das spürt man im Incident: Je mehr Werkzeuge beteiligt sind, desto länger dauert Korrelation, Freigabe und Eindämmung.
Architektur vor Einkauf: Leitplanken, die wirken
Wer das Security Budget spürbar in Schutz umwandeln will, beginnt nicht mit einem neuen RFP, sondern mit Architekturprinzipien:
- Use-Case-First: Erst definieren, welche Top-5-Angriffspfade adressiert werden (Identitäten, E-Mail, Endpunkte, externe Apps, Lieferkette). Danach auswählen, was diese Pfade mit minimaler Redundanz abdeckt.
- Datenfluss als Primat: Telemetrie wird entlang eines gemeinsamen Schemas gesammelt und ausgewertet. Keine Analysen ohne vollständigen, einheitlichen Datenpfad.
- Zero-Trust-Default: Identitäten sind Gatekeeper. Zero Trust erzwingt starke Authentisierung, minimale Rechte und kontinuierliche Prüfung – für Menschen und Maschinenkonten.
- Exit-Plan & Interop: Jede Kernkomponente braucht einen dokumentierten Exit-Pfad (Alternativen, Migrationsschritte). Proprietäre Sackgassen sind zu vermeiden.
- Automatisierung vor Manpower: Standardreaktionen (Isolieren, Sperren, Ticketing) werden automatisiert, damit Analysten echte Angriffslogik prüfen können.
Diese Leitplanken reduzieren Komplexität und schaffen die Voraussetzung, aus weniger Werkzeugen mehr Schutz zu holen.
Metriken statt Meinungen: Was Vorstände sehen müssen
Entscheidend ist, Budgets an Wirkung zu koppeln – nicht an „gefühlte“ Reife:
- MTTD/MTTR (nach Kritikalität): Wie schnell entdecken und beheben wir Vorfälle je Schweregrad?
- Identity Hygiene: Anteil privilegierter Aktionen mit JIT-Freigabe, Quote verwaister Konten, Lebenszyklus für Secrets/Tokens.
- Patch-SLOs: Internet-exponierte Kritikalitäten in Tagen, interne Kritikalitäten in definierten Wochen.
- Coverage: Abdeckung entscheidender Log-Quellen und Endpunkte; getestete Wiederanlaufverfahren pro Geschäftsprozess.
- Tool-Koeffizient: Wie viele Produkte pro Use-Case? Ziel: minimale Anzahl bei maximaler Use-Case-Abdeckung.
Wenn diese Metriken quartalsweise in ein klares Steering einfließen, lässt sich Risikomanagement endlich an Ergebnissen messen – nicht am Umfang der Einkaufslisten.
90-Tage-Plan: Vom Tool-Zoo zur Fähigkeit
Tag 0–15 – Transparenz schaffen
- Inventar aller Security-Tools und Kern-Use-Cases (Phishing, Endpoint, Identity, Web, Supply Chain).
- Zuordnung: Welches Tool liefert welchen belegbaren Beitrag? Doppelungen markieren.
- KPI-Baseline ziehen (MTTD/MTTR, Patch-SLOs, Coverage, Identity Hygiene).
Tag 16–45 – Konsolidieren & härten
- Tool-Konsolidierung: Pro Use-Case maximal eine primäre Plattform + klar definierte Ergänzungen.
- Datenfluss harmonisieren (einheitliches Schema, zentrale Korrelation, klare Alarmkriterien).
- Identitäten priorisieren: phishingsichere MFA, Legacy-Flows abschalten, JIT-Privilegien pilotieren.
Tag 46–75 – Automatisieren & üben
- Standardreaktionen automatisieren (Isolierung, Konto-Sperre, Ticket-Erstellung, Kommunikationspfade).
- Playbooks mit Fachbereichen testen (inkl. Out-of-Band-Kommunikation).
- Disaster-Recovery-Drill für die Top-2-Prozesse durchführen und Zeiten messen.
Tag 76–90 – Nachschärfen & verankern
- KPIs gegen Baseline spiegeln; Lücken mit präzisen Maßnahmen hinterlegen.
- Exit-Pläne für kritische Abhängigkeiten dokumentieren.
- Quartalsweises Steering mit klaren Zielwerten beschließen (Budget folgt Wirkung).
Fazit: Investitionen sichtbar machen – Risiko spürbar senken
Mehr Geld hilft nur, wenn es an Architektur und Wirkung gebunden ist. Wer IT-Sicherheit als Fähigkeit denkt – nicht als Produktsammlung – reduziert Cyberrisiko, beschleunigt Reaktion und senkt Betriebsaufwand. Das Rezept ist nüchtern: saubere Leitplanken, harte KPIs, konsequente Tool-Konsolidierung und ein steuerbares Security Budget. Alles andere ist teure Kosmetik.
[Weitere Informationen finden Sie hier: Cybersecurity] (https://www.ccnet.de/blog/tag/cybersecurity/)
FAQ zum Blogbeitrag
Warum steigt das Risiko trotz höherer Ausgaben?
Tool-Zoo, fehlende Konsolidierung, keine Ende-zu-Ende-Metriken.
Wie verhindere ich Budget-Leerlauf?
Use-Case-First einkaufen, Datenpfad vereinheitlichen, SLOs verankern.
Welche Kennzahl überzeugt Vorstände?
Time-to-Contain je Kritikalität – direkt kostenrelevant.
Ist Plattform statt Best-of-Breed die Lösung?
Nur mit Interoperabilität und Exit-Plan; sonst Lock-in-Risiko.
Was sind schnelle Effekte in 30 Tagen?
Doppeltools stilllegen, Alarmflut trimmen, Automationen für Erstmaßnahmen.